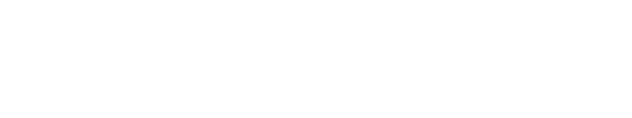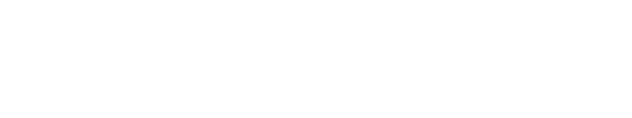Das ist so außergewöhnlich wie ambitioniert: Alle sieben Museen der Stadt Nürnberg gestalten 2025 gemeinsam eine Veranstaltungsreihe. „1945 in Nürnberg – das Ende des zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren“ wartet mit Ausstellungen, Podiumsdiskussionen und wissenschaftlichen Vorträgen auf. Dazwischen aber findet immer wieder persönliches Erleben eine Bühne. Welchen Platz haben individuelle Lebensgeschichten und Erinnerungen im Museum?, fragten wir Thomas Eser, den Direktor der Museen der Stadt Nürnberg. Wie steht es um die Objektivität und was ist die Aufgabe von Museen?
Herr Eser, ist es schwierig persönliche Erfahrung in ein Museum zu integrieren?
Heute nicht mehr, aber es gab lange die Vorstellung, dass gute und seriöse Museumsarbeit auf historischen Quellen und „objektiven“ Artefakten beruhen soll. Individuelle Erinnerung, noch dazu von einfachen Leuten, die sich die Welt geradebiegen und Dinge schönreden, das passte in diesem Verständnis nicht ins Museum. Aber ehrlich gesagt, „objektiv“ als historische Norm ist seit mindestens 50 Jahren erledigt. Warum soll die Erinnerung einer hochgestellten Persönlichkeit, sagen wir mal Angela Merkel, besser sein als die eines „normalen“ Zeitzeugen?
Aber Zeitzeugen gelten doch auch vor Gericht als notorisch unzuverlässig, weil sie eben ganz individuelle Perspektiven haben und Erinnerungen aus dem Moment entstehen.
Wir müssen als Historiker fähig sein, persönliche Erinnerung zu gewichten und einzuordnen. Wir müssen vorsichtig und kritisch damit umgehen. Aber das gilt genauso für amtliche historische Zeugnisse: Auch Aktenvermerke oder Stadtratsprotokolle sind von einer Person verfasst worden, die etwas weggelassen haben könnte oder einen Sachverhalt womöglich nicht richtig verstanden hat.
Bemühen sich Museen denn um persönliche Geschichten?
Ja, das tun wir. Zum einen, weil Berichte von Zeitzeugen wichtige Quellen sind. Und zum anderen, weil wir von Besuchenden wissen: Was zu einem attraktiven Museumsbesuch immer zählt, sind Geschichten. Geschichten von Menschen, die ein Kunstwerk geschaffen haben. Geschichten über die, die darauf abgebildet sind. Oder Erzählungen von Menschen, die ein historisches Ereignis miterlebt haben.
Gibt es Beispiele aus Nürnberg?
Das Museum Industriekultur und seine Vorläufer war in den 1970ern und 80ern ein Vorreiter der sogenannten Oral History: Es wurden hunderte von Zeitzeugeninterviews zum Strukturwandel in der Industriestadt Nürnberg geführt, gerade mit ganz normalen Arbeitern. Gerade versuchen wir, die Tonbandaufnahmen von damals in einem aufwendigen Verfahren zu sichern, weil sie so einzigartig sind. Oder das Spielzeug, das eignet sich besonders gut: Es gibt zu jedem Spielzeug immer eine Herstellungsgeschichte, es gibt einen Sammlerwert und viele persönliche Erzählungen. Wichtiger als die Herstellerfrage zum abgeschmusten Teddys ist vielleicht die Geschichte seiner Besitzerin und was der Teddy für sie bedeutet hat.
Hier ein Beispiel für eine Ausstellung mit Berichten von Zeitzeugen im Spielzeugmuseum:
Notspielzeug. Die Phantasie der Nachkriegszeit
Wie kommen Museen solchen emotionalen Geschichten auf die Spur?
Über einen Aufruf in der Lokalzeitung konnten wir die Retterinnen des Albrecht-Dürer-Hauses ausfindig machen. Wir kannten nur die Namen der beiden Frauen, die im Krieg einen Brand im historischen Haus gelöscht haben und es vor der Zerstörung bewahrten, wussten aber nicht, was aus ihnen wurde. Über die Zeitung fanden wir die Nachkommen. Außerdem gibt es ein gutes Netzwerk in der Stadt. Das Stadtarchiv ist ein wichtiger Partner und auch die Engagierten von Geschichte Für Alle e.V. kennen viele Einzelschicksale. Und drittens fragen wir im Bekannten- und Kollegenkreis.

Die Retterinnen des Albrecht-Dürer-Hauses: Marie Falcke mit ihrer Tochter Gertrud, 1933. Bildnachweis: Privatarchiv
Werden den Museen denn auch Geschichten angetragen? Nicht wenige Menschen wünschen sich ja im Alter, dass ihre Erinnerungen bleiben und würden gern erzählen.
Da müssten wir noch viel häufiger offene Ohren haben, zugegeben. In der Regel wird uns ja ein Objekt mit oder ohne persönliche Geschichte angeboten oder gleich ein ganzer Haushalt aufgelöst. Das Selektieren, was wir tatsächlich bauchen können, und welche Geschichten auf Dauer erinnerungswürdig sind, bringt sehr großen personellen Aufwand mit sich. Das Sammeln von Objektgeschichten können wir in den Museen deshalb nicht immer in wünschenswerter Ausführlichkeit leisten. In der Regel lehnen wir größere Schenkungen ab: Oft haben wir Ähnliches schon, oft fehlt der Platz zur Aufbewahrung oder Geschichte und Objekt sind für unsere Aufgabe irrelevant. Und oft bekämen wir nur das Objekt – noch nicht die Geschichte. Intensiv verfolgen wir individuelle Geschichten jedoch bei Oral History-Projekten, bei denen Wissenschaftler und Historikerinnen das Sammeln von Informationen als Hauptaufgabe haben.
Ist es einfacher lokale Geschichte/n zu erzählen als Weltgeschichte?
Nein, eigentlich ist es viel leichter, denn wir haben auf lokaler Ebene Mensch und „Sache“ noch verbunden. Bei großen Werken der Kunstgeschichte, die durch den Kunsthandel schwirren und vorher im Besitz zehn reicher Sammler waren, ist diese Verbindung von Objektgeschichte, Emotion und Menschenbezogenheit oft schon verloren.
Wenn persönliche Geschichten so an Bedeutung gewonnen haben für die Vermittlung, spielt denn Objektivität überhaupt noch eine Rolle in den Museen?
Ich würde eher von Seriosität und Vertrauenswürdigkeit sprechen. Das Institut für Museumsforschung hat letztes Jahr eine Umfrage gemacht, welche Institutionen und welches persönliche Umfeld vertrauenswürdig sind. An erster Stelle nannten die Befragten Familie und Bekannte, an zweiter folgten schon die Museen – noch vor der Wissenschaft, dem Journalismus und weit vor den sozialen Medien. Museen gelten für manche Menschen vielleicht ein bisschen langweilig, auch wenn wir daran arbeiten, aber sie gelten auch als seriös. Das wollen wir bewahren.
Studie „Das verborgene Kapital: Vertrauen in Museen in Deutschland“

Titelbild zur Veranstaltungsreihe: Blick auf die kriegszerstörte Innenstadt Nürnbergs. Bildnachweis: Stadtarchiv Nürnberg A 65/II Nr. RA-275-D, Foto: Raymond D’Addario
Das ist auch eine Frage des Selbstverständnisses, oder?
Die Kernaufgabe von Museen ist, dass wir Informationen sammeln und den Besuchenden gut aufbereitet mitteilen. Wir tun das in der Regel mit interessanten Objekten, Exponaten und deren Geschichten. Meiner Meinung sollten wir uns dabei nicht instrumentalisieren lassen als Meinungsmacher für diese oder jene politische und gesellschaftliche Debatte. Aktuell ist aber die Diskussion in vollem Gang, ob Museen nicht doch mehr Haltung zeigen und deutlicher Werte vermitteln müssten, und nicht nur Information. Gerade die Jüngeren wünschen sich das. Ich persönlich bin da skeptisch: Unser Kapital, das zeigt die Umfrage, ist der Vertrauensvorschuss der Gesellschaft, dass Museen nach bestem Wissen und Gewissen erzählen, wie es gewesen ist, und die Quellen dazu darlegen. Und es nicht unsere primäre Aufgabe ist, dass wir „die Welt besser machen“. Denn wer wäre dann unser Adressat? Sollen wir unsere Meinung dezidierter sagen, damit aber nur bei Gleichgesinnten andocken? Oder liefern wir besser mit guten Pro- und Contra-Argumenten die Grundlage zur Meinungsbildung und stellen es den Besuchenden frei, wie sie sich dazu verhalten wollen? Das halte ich für die reizvollere Aufgabe.
Informationen zur Veranstaltungsreihe
1945 in Nürnberg. Das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren